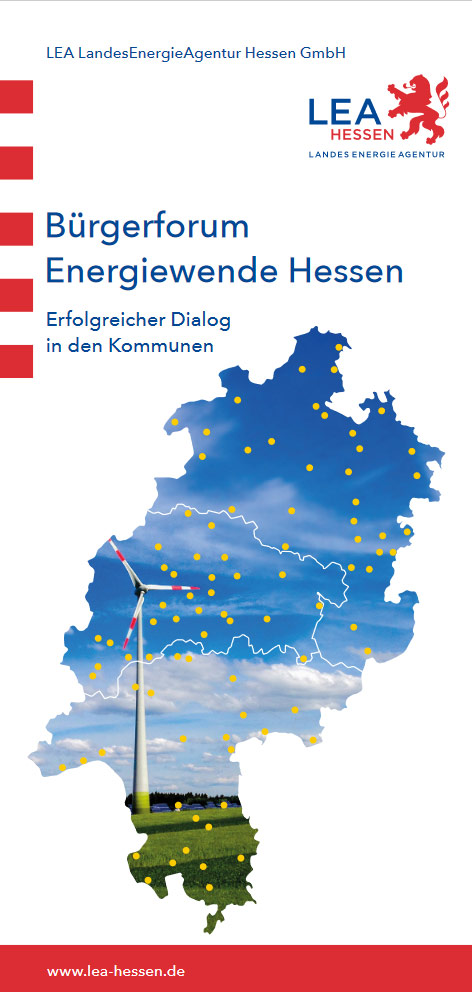Im Vorfeld wurden Fragen durch die Bürger eingereicht, die Antworten der Experten finden sie nun hier.
Welche Auswirkungen hat der weitere Zubau von Erneuerbare Energie Anlagen auf die Stromkosten (siehe: https://www.vernunftkraft-odenwald.de/zahlen-der-stromboerse-leipzig/)?
Der Börsenstrompreis hängt von verschiedenen Faktoren ab. Windenergieanlagen, die heute mit einer EEG-Vergütung ans Netz gehen, erhalten für 20 Jahre einen marktabhängigen Vergütungssatz pro erzeugter Kilowattstunde Strom. Zwischen 2014 und 2020 konnte die erneuerbare Stromerzeugung um 52% gesteigert werden. Gleichzeitig ist die EEG-Umlage stabil geblieben. [Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2019) EEG-Umlage 2020: Fakten & Hintergründe https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/XYZ/zahlen-fakten-eeg.pdf?__blob=publicationFile&v=4] (PNE AG / Landesenergieagentur Hessen)
Der erzeugte Strom der sechs Windenergieanlagen entspricht bilanziell dem Verbrauch von ca. 23.000 Durchschnitts-Haushalten. Der Strom wird direkt in das öffentliche Netz eingespeist. Schwankungen in der Stromeinspeisung von Windenergieanlagen oder Photovoltaikanlagen werden durch regelbare Erzeuger und Verbraucher sowie Speicher ausgeglichen. Reichen die Netzkapazitäten nicht aus, um den erzeugten Strom abzutransportieren, können die Windenergieanlagen vom Netzbetreiber abgeregelt werden. Insgesamt werden ca. 97 % des eingespeisten Stroms aus Erneuerbaren Energien abtransportiert und genutzt [Monitoringbericht (2019) Bundesnetzagentur - S. 155-157: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2019/Monitoringbericht_Energie2019.pdf?__blob=publicationFile&v=6]. (PNE AG)
Die Windvorranggebiete wurden auf der Ebene der Regierungsbezirke ermittelt und von den Regionalversammlungen beschlossen. Bei der Ausweisung der Flächen fanden viele Kriterien Berücksichtigung, u. a. der Abstand zu Siedlungen, naturschutzfachliche Aspekte und nicht zuletzt auch die generelle Windhöffigkeit. Auch an schwächeren Windstandorten können moderne, darauf ausgelegte Windenergieanlagen wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden. Der dezentrale, möglichst flächendeckende Ausbau dient dazu, die Kosten für den Energietransport zu minimieren. (Landesenergieagentur Hessen)
Walderhaltung und der Ausbau der Erneuerbaren Energien sind gleichermaßen angewandter Klima- und Umweltschutz. Beide Ziele müssen konsequent verfolgt und in Einklang gebracht werden. Für den Raumbedarf von insgesamt 2 % der Landesfläche in Hessen für die Windenergie werden auch Waldgebiete in Anspruch genommen, und zwar ohne die Waldstruktur übermäßig zu beinträchtigen: Denn forst- und naturschutzfachlich wertvolle Bestände - auch innerhalb von Windvorranggebieten - werden geschont. Dieser Grundsatz der „Eingriffsminimierung“ gilt immer. Anlagenplanung und Trassenführung werden dementsprechend beispielsweise entlang der vorhandenen Forstwege gelegt. (Landesenergieagentur Hessen)
Pro Windenergieanlage soll im Durchschnitt 1 ha Wald verloren gehen. Warum baut man nicht auf landwirtschaftlichen Flächen, die bei uns im Hinterland von Natur aus schon sehr karg sind und nur grenzwertig wirtschaftlich der Lebensmittelerzeugung dienen? Der Schaden für Klima und Umwelt, der durch Versiegelung entsteht, ist im Wald erheblich höher.
Windvorranggebiete werden nach bestimmten Kriterien ausgewiesen. Das durchschnittliche Windaufkommen (Windhöffigkeit) ist ein Kriterium für die Standortauswahl. Die Windhöffigkeit dient als Maßstab für die Gewinnung von Windenergie. Die Windhöffigkeit ist vor allem auf Bergkuppen, die in Hessen meistens bewaldet sind, am höchsten.
Für eine Berechnung, wie viel Waldfläche in Hessen durch die Windenergie benötigt wird, kann man den unmittelbaren Flächenverbrauch für eine Anlage zugrunde legen (dauerhaft und temporär zusammen etwa 0,6 bis 1 Hektar).
Strenge Naturschutzauflagen verpflichten die Betreiber der Anlagen zum ökologischen Ausgleich dieser Waldrodung durch Wiederaufforstung und andere strukturelle Aufwertungen in der Kulturlandschaft. Zuwegungen und sonstige Maßnahmen, die im Zeitraum der Errichtung der Anlage notwendig sind, müssen nach Vollendigung des Baus rückgebaut werden. Auch Untersuchungen der Auswirkungen auf Vögel sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen öffentlich ausgelegt werden. (Landesenergieagentur Hessen)
In Hessen macht Wald ungefähr 42 Prozent der Landesfläche aus, das sind rund 894.000 Hektar. Dies macht Hessen zum waldreichsten Bundesland Deutschlands.
Etwa 80 Prozent der Windvorrangflächen liegen in den bewaldeten Höhenlagen. Dies erfordert – aus ökologischen wie wirtschaftlichen Gründen – eine besonders genaue und eingriffsminimierende Planung. Um die Auswirkung auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten, werden das bestehende Wegenetz und etwaige Windbruchflächen in die Standortplanung einbeziehen. So können der Rodungsbedarf und Flächenverbrauch deutlich verringert werden.
(Landesenergieagentur Hessen)
Um unregelmäßige Energieproduktion von Windparks auszugleichen, sind konventionelle Kraftwerke gezwungen, ihre Produktion hoch- und runterzufahren, was zu erhöhtem Energieverbrauch und CO2 Ausstoß führt. Es müssen auch zwangsläufig immer mehr fossile Kraftwerke neu gebaut werden (z. B. Datteln), um die Produktion des Zufallstroms aus Windkraft zu stabilisieren. Experten haben nachgewiesen, dass die Windkraft bei Berücksichtigung aller Fakten daher die gesamt CO2 Bilanz nicht verbessern kann. Liegen Ihnen diese Berechnungen vor?
Erneuerbare Energien weisen im Vergleich zu konventionellen Energieerzeugungsformen die mit Abstand geringsten spezifischen CO2-Emissionen aus. Übergangsweise werden konventionelle Kraftwerke für den Ausgleich der Schwankungen benötigt. Während ein konventionelles Kraftwerk pro Kilowattstunde erzeugten Stroms eine CO2 Bilanz von etwa 800g/kWh aufweist, liegt diese bei WEAs bei lediglich etwa 20g/kWh. Der wachsende Anteil der EE am Strommix führt also nicht zu einer Erhöhung, sondern zu einer Verdrängung der konventionellen Erzeugungsträger. Weniger Energiegewinnung aus Kohle, Öl und Gas sorgt insgesamt für weniger Emissionen.
Diverse Technologien, um Energie zu speichern, sind bereits entwickelt (z.B. Druckspeicher, Batteriesysteme, chemische Speicher). Mit der Zunahme des Anteils an Erneuerbarer Energie im Stromnetz werden diese Speicher wirtschaftlich immer interessanter und zunehmend gebaut.
(Landesenergieagentur Hessen)
Der Anteil der Windenergie am Primärenergieverbrauch in Hessen beträgt lediglich 1,5 % (Quelle: Energiewende in Hessen - Monitoringbericht 2019, Abb. 21, der Anteil an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 46 % ebenda Abb. 24). Relevant für die Klimawirksamkeit ist allein die Zahl 1,5 %, also ein vernachlässigbar kleiner Teil. Der Erzeugung von Energie aus Windkraft wird hingegen eine große Bedeutung im Hinblick auf die Energiewende beigemessen. Frage: Wie hoch müsste der Windkraftanteil steigen, um das politisch anvisierte Energieziel in Hessen bis 2030 zu erreichen und wie viele WEAs wären dafür erforderlich?
Der Primärenergieverbrauch beinhaltet neben dem Strombedarf aktuell auch viele fossile Verbrennungsprozesse in den Bereichen Gebäudeheizung (Wärme) und Verkehr, die bis 2050 durch Elektrifizierung deutlich effizienter werden sollen. Aus dieser Elektrifizierung und auch durch Gebäudesanierung wird in den Sektoren Wärme und Verkehr der Energiebedarf bis 2050 deutlich sinken. In diese Senkung des Energieverbrauchs fließen zahlreiche Landes- und Bundesfördermaßnahmen.
Der Stromanteil am Endenergieverbrauch in Hessen beträgt lediglich 15,7 %.
Weiterhin ist Hessen bislang ein Energieimportland und erzeugt nur 16,5 TWh von benötigten 36,7 TWh Bruttostrom selbst (Importquote von 55%).
Der Energieanteil der Windkraft ist daher nur aussagekräftig, wenn der Anteil an der Inlandsstromerzeugung berechnet wird und nicht am Gesamtenergieverbrauch Hessens, in den z.B. auch der Bedarf des Frankfurter Flughafens allein mit einem guten Viertel eingeht.
Der aktuelle Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung (3,68 TWh von 16,5 TWh) ist mit 22% deutlich sichtbar (Stand 2018) und steigt weiter. Das Ziel in Hessen besteht darin, bis 2050 28 TWh durch Windkraft zu erzeugen, auf 2% der Landesfläche. Dies wird mit bis zu 2.000 WEA und im Rahmen der fortschreitenden technischen Entwicklung erreicht werden können.
(Landesenergieagentur Hessen)
Der richtige Mix verschiedener erneuerbarer Energien sichert die Versorgung: Solar- und Windenergie produzieren je nach Wetter und Tageszeit unterschiedlich viel Strom. Diese Schwankungen werden durch ergänzende Energien so ausgeglichen, dass zu jeder Zeit der Bedarf gedeckt werden kann. Übergangsweise werden dafür weiterhin konventionelle Kraftwerke benötigt. Um in Zukunft komplett CO2-neutral zu sein, müssen auch die Reservekraftwerke klimaneutral werden, z. B. mit synthetischem Methan aus erneuerbaren Energien.
(Landesenergieagentur Hessen)
Aufgrund von Studien bzgl. der Auswirkungen von Windrädern auf die Gesundheit der Bevölkerung (Lärm, Infraschall etc) fordern namhafte Mediziner (deutsches Ärzteblatt – Medizinreport Infraschall - Studien der Uni Mainz) und Schallforscher (Prof. Dr. Müller zum Hagen) größere Sicherheitsabstände (mindestens 2000 m oder 10-fache Höhe). Die für die emissionsrechtliche Genehmigung gültige TA Lärm DIN 45680 sowie DIN 9613-2 für Schallpegelmessung sei veraltet, da sie sich auf Messungen von wesentlich niedrigeren Windrädern beziehe und die Schallrealität der heutigen 240 m hohen WEAs nicht widerspiegele. Experten des Umweltbundesamtes halten weitere Forschungen für erforderlich. Frage: Wie hoch schätzen Sie das Gefährdungspotential der Anwohner bei einem geplanten Mindestabstand von nur 1000 m ein?
Im Vergleich mit anderen technischen und natürlichen Quellen ist der von Windkraftanlagen hervorgerufene Infraschall gering. Bereits in 150 m Abstand liegt er deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen. Gesundheitliche Wirkungen von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen sind wissenschaftlich nicht nachgewiesen. (siehe: https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/47998-Tieffrequente_Geräusche_durch_Windenergieanlagen.pdf und https://www.energieland.hessen.de/pdf/Faktenpapier_Windenergie_und_Infraschall_2015.pdf)
Neben der TA Lärm werden auch neuere Erkenntnisse verwendet, um z. B. den höheren Windenergieanlagen Rechnung zu tragen. Daher wird im Schallgutachten das sogenannte Interimsverfahren angewendet.
Der Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Infraschall wird im Genehmigungsverfahren geprüft.
(PNE AG)
Die Erfahrungen mit den WEAs im Hinterland haben gezeigt, dass nicht wenige Bürger an deren Emissionen leiden, so klagen manche über Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen u.a. Symptome und dass kein Entfliehen möglich sei. Frage: Werden Sie bei Beschwerden von Bürgern bzgl. der Emissionen der WEAs realistische und objektive Lärmpegelmessungen durchführen und ggf. Abschaltalgorithmen vornehmen?
Beschwerden sind an das Regierungspräsidium Gießen zu richten. Sollten begründete Zweifel an der Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte des Schallpegels vorliegen, kann eine anlassbezogene Messung gefordert werden. Sollten die Grenzwerte tatsächlich nicht eingehalten werden, können u. a. Änderungen an den Abschaltalgorithmen vorgenommen werden.
(PNE AG)
Abregelungen von EEG-Anlagen entschädigt der Netzbetreiber dem Anlagen-Besitzer. Die hier entstehenden Kosten werden auch über die EEG-Umlage weitergegeben. Auf der anderen Seite sorgt ein Überangebot am Strommarkt für niedrige oder negative Börsenpreise, sodass der Preis für den Endkunden nicht zwangsläufig steigen muss. Geben Energieversorger nur die Kosten und nicht auch die Preisvorteile an ihre Kunden weiter, kann der Verbraucher z.B. durch einen Anbieterwechsel reagieren.
(Landesenergieagentur Hessen)
Die Wirtschaft und die Verbraucher/Bürger nutzen immer stärker IT-Technik und Rechenzentren, die einen hohen Stromverbrauch haben. Daher ist es umso wichtiger, die Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien umzustellen.
Inwieweit der Eigenstromverbrauch der Windenergieanlage und der Verbrauch im Rahmen der technischen Betriebsführung berücksichtigt werden, hängt von der jeweiligen CO2-Bilanzierung ab.
(PNE AG)
Die Stadt Gladenbach ist in diesem Falle zu sehen wie eine Privatperson, die ihre Flächen an den Projektierer verpachtet. Ein endgültiger Beschluss zur Verpachtung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gladenbach steht noch aus. Derzeit werden der Vertragsentwurf geprüft und danach wird der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung eine Beschlussempfehlung vorlegen. Auch die Nutzung der Wege wird durch die Stadtverordnetenversammlung geregelt werden. (Stadt Gladenbach)
Die Stadt Gladenbach, der Projektierer PNE und das Bürgerforum Energieland Hessen arbeiten gemeinsam daran, die Bürgerinnen und Bürger informiert zu halten. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie sollen Gelegenheiten für den wichtigen persönlichen Austausch geschaffen werden. Sollten sich Möglichkeiten einer Informationsveranstaltung vor Ort ergeben, werden diese genutzt.
Aus Sicht der Stadt Gladenbach ist es zwingend notwendig, die Bevölkerung ausführlich zu informieren und den Dialog zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen. Wie bereits in einer anderen Frage erwähnt steht die endgültige Beschlussfassung über die Verpachtung städtischer Flächen noch aus. Dies wird sicherlich noch in diesem Jahr geschehen.
Auch der Projektierer ist sehr daran interessiert, eine Info-Veranstaltung durchzuführen. Derzeit werden die Antragsunterlagen zusammengestellt. Vor der Genehmigung wird jede Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit erhalten, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorhaben zu äußern.
(Stadt Gladenbach, PNE AG, Landesenergieagentur Hessen)
Das "Bürgerforum Energieland Hessen" (BFEH) unterstützt die Stadt Gladenbach dabei, zur Versachlichung der aktuellen Diskussion rund um das Windenergie-Projekt beizutragen. Die Stadt Gladenbach hat das BFEH um Unterstützung gebeten, einen allparteilichen Dialog zu führen und gleichzeitig über das geplante Projekt in der Öffentlichkeit transparent zu informieren. Insofern unterstützen wir die Verwaltung bei der Planung und Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen rund um das Windenergie-Projekt. (Landesenergieagentur Hessen)
Die Gemeinde Dautphetal, der Projektierer PNE und das Bürgerforum Energieland Hessen arbeiten gemeinsam daran, die Bürgerinnen und Bürger informiert zu halten. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie sollen Gelegenheiten für den wichtigen persönlichen Austausch geschaffen werden. Sollten sich Möglichkeiten einer Informationsveranstaltung vor Ort ergeben, werden diese genutzt.
Aus Sicht der Gemeinde ist es zwingend notwendig, die Bevölkerung ausführlich zu informieren und den Dialog zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen.
Auch der Projektierer ist sehr daran interessiert, eine Info-Veranstaltung durchzuführen. Derzeit werden die Antragsunterlagen zusammengestellt. Vor der Genehmigung wird jede Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit erhalten, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorhaben zu äußern.
(Gemeinde Dautphetal, PNE AG, Landesenergieagentur Hessen)
Das "Bürgerforum Energieland Hessen" (BFEH) unterstützt die Gemeinde Dautphetal dabei, zur Versachlichung der aktuellen Diskussion rund um das Windenergie-Projekt beizutragen. Die Gemeinde Dautphetal hat das BFEH um Unterstützung gebeten, einen allparteilichen Dialog zu führen und gleichzeitig über das geplante Projekt in der Öffentlichkeit transparent zu informieren. Insofern unterstützen wir die Verwaltung nicht bei der Umsetzung eines Gemeindebeschlusses, sondern bei der Planung und Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen rund um das Windenergie-Projekt. (Landesenergieagentur Hessen)
Prinzipiell werden für die Zuwegung die vorhandenen Wege genutzt, und wo es nötig ist, ausgebaut. Das geschieht mittels Schotterung oder temporär verlegter Alu-Platten. Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dabei dem Anlagenbetreiber. Die Eigentümer können weiterhin ihre Wege nutzen. Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, nach Vertragsende die Wege wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Oftmals sind die Wege nach der Errichtung des Windparks in einem besseren Zustand als vorher.
(PNE AG)
Diedenshausen ist der Ortsteil, wo man fünf Anlagen im Blickfeld hat. Es wird sich für den Ort einen erheblichen Flugschatten und vermutlich auch eine größere Geräuschkulisse ergeben. Man sollte mit dem Ort Diedenshausen über Vergünstigungen sprechen, da sie nach jetzigem Stand nur Nachteile erhalten werden. Die Bereitschaft sich in diesem kleinen Ort im Ohetal niederzulassen als Familie wird durch dieses Projekt deutlich minimiert.
Die Anlagen werden sicherlich von Diedenshausen aus gesehen. Dies wird nicht bestritten. Der am nächsten gelegene Anlagenstandort ist allerdings fast 1,5 Kilometer entfernt. In wie weit diese Anlagen dann über evtl. Schlagschatten oder evtl. Geräuschimmissionen die Qualität des Wohnens in Diedenshausen beeinflussen können, werden die Untersuchungen zeigen.
Direkte Vergünstigungen kommen sicherlich Einzelnen (Pacht), aber auch der Gesamtheit der Gladenbacher Bevölkerung in Form von Einnahmen insgesamt zugute.
(Stadt Gladenbach, PNE AG, Landesenergieagentur Hessen)
Durchschnittlich ist ein Rodungsfläche von 0,87 ha pro Windenergieanlage notwendig. Davon werden 0,47 ha dauerhaft gerodet und 0,40 ha temporär für die Bauphase gerodet (Quelle: FA Wind 2020). Die temporär genutzten Flächen können bis zum Abbau der Windenergieanlagen forstwirtschaftlich genutzt werden. Aktuell wird die Turmdrehkrantechnik immer weiterentwickelt. Damit könnte die Rodungsfläche für den Rückbau zukünftig weiter reduziert werden.
Im konkreten Projekt sind die Rodungsflächen noch nicht abschließend bilanziert. Sie werden voraussichtlich geringer ausfallen, da die Anlagen teilweise auf Freiflächen und Windwurfflächen stehen. Zudem sind Flächen enthalten, welche ohnehin aufgrund von Borkenkäferschäden gerodet werden müssen. Überschlägig ermittelt dürfte die dauerhaft und temporär gerodete Fläche im Windpark ca. 0,63 ha pro Windenergieanlage betragen.
(PNE AG)
Nach der Antragstellung werden die Unterlagen durch das RP Gießen auf Vollständigkeit geprüft. Dieser Vorgang benötigt erfahrungsgemäß mehrere Monate. Da wir ein förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung wählen, werden im Anschluss die Antragsunterlagen öffentlich ausgelegt und die Bürger können Ihre Einwende und Anregungen zum Windparkvorhaben im Rahmen des Genehmigungsprozesses einbringen. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung wird nach der geplanten Informationsveranstaltung stattfinden. Für die Informationsveranstaltung selbst ist es aus unserer Sicht sinnvoll, dass die Planung hinreichend konkretisiert ist, um häufige Fragen nach der WEA-Anzahl, den Standorten sowie den Auswirkungen auf Schall, Schatten, etc. beantworten zu können.
(PNE AG)
Die "Präsentation des Projektierers" enthält bis auf die nicht nachvollziehbaren Visualisierungen nur allgemeine einseitige Mitteilungen zu Windparks und vage Möglichkeiten zur Finanzierung und Bürgerbeteiligung. Diese sind ausdrücklich mit einem "Disclaimer" versehen. Spezielle Fragen zu konkreten Planungen ergeben sich daher nicht. Welches Programm wurde für die Visualisierungen benutzt und wird dieses landesweit uneingeschränkt anerkannt?
Die Visualisierung wurde nach den anerkannten Regeln der Technik und mit der Software WindPRO erstellt.
(PNE AG)
Mit dem Inkrafttreten des Energiesammelgesetzes ist die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung ab Juli 2020 für alle Windenergieanlagen verpflichtend. Die nächtliche Beleuchtung ("Blinken") setzt also nur ein, wenn sich ein Flugobjekt nähert. Das wird im geplanten Windpark selten vorkommen. Dem "Discoeffekt" wird vorgebeugt, indem die Rotorblätter moderner Windenergieanlagen matt beschichtet werden.
(PNE AG)
Das Fundament wird nach einer Baugrunduntersuchung festgelegt. Diese ist noch nicht erfolgt. Der Durchmesser beträgt zwischen 23,5 m und 27 m, und die Tiefe liegt zwischen 2,2 m und 2,6 m. Das Fundament wird vollständig zurückgebaut. Die Kosten dafür trägt der Anlagenbetreiber. Um das sicherzustellen, muss eine Rückbaubürgschaft hinterlegt werden. Die Höhe der Bürgschaft wird von der Genehmigungsbehörde festgesetzt.
(PNE AG)
Die Risiken sind durch die Genehmigungsplanung relativ gering gehalten. Die finanzierenden Banken werden nur in Anlagen investieren, die Erträge in entsprechender Form erwirtschaften. Der Rückbau ist in Form von Rückbaubürgschaften abzusichern. Durch vertragliche Regelungen einer Mindestpacht hat die Stadt jährliche Einnahmen. Damit können im Gegenzug mehr Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden als ohne diese Einnahmen.
(Stadt Gladenbach)
Wie groß ist der Gefahrenbereich der geplanten Windenergieanlagen im Havariefall oder bei Eiswurf im Winter? Beispiel: am 8. März 2018 ist in Borchem-Etteln, Kreis Paderborn, ein neues Windrad durch Überdrehzahl zerstört worden. Trümmer der Rotorblätter sind bis zu 800 Meter Entfernung vom Standort aufgefunden worden und haben ca. 80 Hektar landwirtschaftlicher Flächen kontaminiert, die daraufhin sofort für die Nutzung zur Produktion von Lebensmitteln und Tierfutter gesperrt wurden. Diese Anlage hatte eine Nabenhöhe von 149 Metern und einen Rotordurchmesser von 115,7 Metern. Da bei uns Anlagen mit Nabenhöhen von ca.166 Metern und Rotordurchmesser von ca. 160 Metern geplant sind, muss man von einem Gefährdungsradius ausgehen, der deutlich größer als 800 Meter ist.
Die maximale Fallweite von Eisstücken bei einer Windgeschwindigkeit von 20 m/s beträgt je nach Anlagenstandort zwischen 250-300 Meter Im Brandfall wird ein Bereich von 700 Metern um die Windenergieanlage abgesperrt.
Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Unfalls ist äußerst gering.
(PNE AG)
- Rahmenpräsentation Infomarkt 'Windenergie in Gladenbach' [PDF, 5.1 MB]
- FAQ – 1. Fragekatalog Gladenbach [PDF, 121 KB]
- FAQ – 2. Fragekatalog Gladenbach (Stand 06.08.2020) [166 KB]
- Informationsbrief Gladenbach [PDF, 874 KB]
- Karte des Gladenbacher Gemeindegebietes [PDF, 1.5 MB]
- Präsentation des Projektierers (PDF, 2 MB)
- Bundesverband WindEnergie e.V.
- Bundesverband Erneuerbare Energie
- EnBW
- Deutscher Naturschutzring
- NABU
- Nordrhein-Westfalen - Energiedialog NRW
- Mecklenburg-Vorpommern - Fragen und Antworten zum Thema Wind
- Thüringen - Servicestelle Windenergie
- Baden-Württemberg - Energiewende Baden-Württemberg
- Internationale Energieagentur
- European Wind Energy Association
- Schweizer Agentur für Erneuerbare Energie und Energieeffizienz
- Agentur für Erneuerbare Energien - Föderal Erneuerbar
- Forschungsradar Energiewende